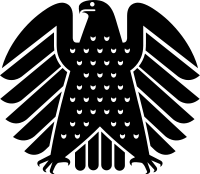Beitrag in der Wochenzeitung „Die Zeit“ vom 3. April 1998
Manchmal wird es im Bundestag richtig spannend. Dann gibt es keine „Kanzlermehrheit“ und keine „Fraktionsdisziplin“ mehr, dann dient das Parlament nicht nur als Notar anderswo ausgehandelter Beschlüsse der Regierungskoalition, sondern die Abgeordneten kämpfen an Ort und Stelle um eine Mehrheit, die nicht vorher schon feststeht. Über eine „Sternstunde“ des Parlaments jubeln dann meist die Medien – wohl vor allem deshalb, weil im Bundestag die ergebnisoffene Diskussion als etwas ziemlich Ungewöhnliches erscheint.
Wichtige Abstimmungen quer zu den Stimmblöcken von Regierungs- und Oppositionsparteien gab es bisher in der Tat eher selten: Die Hauptstadtfrage Bonn/Berlin wurde so entschieden; die Neuregelung des Abtreibungsrechts war von den Fraktionsführungen dem Gewissen der Abgeordneten anempfohlen; ebenso das Transplantationsgesetz; gleiches zeichnet sich nun bei Zustimmung zu oder Ablehnung der Bioethik-Konvention ab. Die überraschende linksliberale Mehrheit für Einschränkungen beim großen Lauschangriff wird dagegen als Niederlage für Kanzler und Koalition gewertet. Solch ein Unglück haben die parlamentarischen Mehrheitsführer von CDU, CSU und FDP bei der Abstimmung über die doppelte Staatsbürgerschaft mit großem Druck verhindert. Sie verweisen auf Koalitionstreue, Koalitionsvertrag und die bevorstehenden Wahlen.
Geschlossenheitsrituale gehören fast von Beginn an zur Inszenierung von Regierungsfähigkeit in der Bonner Republik. Mit der Weimarer Erfahrung im Gepäck war das vernünftig. Aber bleibt es vernünftig angesichts der beinah schon extremen Stabilitätserfahrungen der Bundesrepublik Deutschland (mit bisher gerade mal drei Regierungswechseln 1966, 1969 und 1982) und angesichts eines verbreiteten Unmuts über unseren „Parteienstaat“?
Koalitionsvereinbarungen müssen sein, wenn die Stimmen einer Partei allein nicht ausreichen, einen Kanzler und damit die ganze Bundesregierung ins Amt zu wählen. Doch müssen Koalitionsverträge alles, was nur irgendwie vorhersehbar ist, verbindlich regeln? Und ist die übliche Einvernehmensklausel, daß wechselnde Mehrheiten im Parlament zu vermeiden seien, wirklich nötig? Auch SPD und Grüne schließen in den Ländern solche Verträge – auf daß keine Partei bei passender Gelegenheit fremdgehen und kein Abgeordneter der Orientierungslosigkeit offener Abstimmungen ausgeliefert sein möge.
Den vierten Regierungswechsel vor Augen, auf dem Weg nach Berlin, 49 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik sollte nun aber die Zeit für Lockerungsübungen gekommen sein. Koalitionspartner gründen keine Lebensgemeinschaft, sie müssen nicht Einigkeit in allen Fragen herbeiführen oder heucheln, müssen nicht in Treue fest auf der Stelle treten, wo beide eigentlich in verschiedene Richtungen streben. Ein Koalitionsvertrag kann auch ein Kapitel enthalten, das übereinstimmend feststellt, was nicht einigungsfähig und -bedürftig war und folglich offen bleibt. In solchen Fragen sollten die Partner wechselnde Mehrheiten oder auch gänzlich offene Abstimmungen akzeptieren. Die Regierungsfähigkeit bliebe davon unberührt. Und im Bundestag würde es vielleicht nicht immer, aber immer öfter richtig spannend.