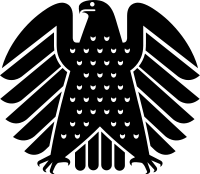Als Bundespräsident Joachim Gauck, Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Februar 2014 auf der Münchener Sicherheitskonferenz jeweils ihre sicherheitspolitischen Vorstellungen darlegten, reagierte die deutsche Öffentlichkeit überrascht. Es ginge den Rednern um die Ausweitung deutscher Militäreinsätze, lautete damals der kritische Medientenor. Eine Abkehr von der „Kultur der militärischen Zurückhaltung“ wurde in die Auftritte der drei hineininterpretiert. Aber darum ging es nicht. Die Reden sollten vielmehr den Anstoß geben für eine breite öffentliche Debatte über Deutschlands Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt. Es handelt sich dabei mitnichten um einen Paradigmenwechsel, sondern eine Weiterentwicklung unserer Außenpolitik.
Doch die Debatte hat bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auch die Sorge genährt, dass ein stärkeres außenpolitisches Engagement zu einer „Militarisierung“ der deutschen Außenpolitik führen müsse. Dabei sprechen die Fakten eine andere Sprache: Tatsächlich sind derzeit nur rund 2500 der insgesamt 180.000 Bundeswehrsoldaten im Ausland eingesetzt – so wenige wie seit fast zwanzig Jahren nicht mehr. Zu Spitzenzeiten waren es fast 11.000. Das Zerrbild eines kraftmeiernden Militärinterventionismus, das Kritiker gerne zeichnen, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wer die Qualität der deutschen Außenpolitik ausschließlich an der Bereitschaft zu militärischem Handeln misst, der unterschlägt, dass Deutschland die gesamte Bandbreite des außenpolitischen Instrumentenkastens einsetzt – von diplomatischer Vermittlung über zivile Konfliktprävention bis hin zu humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.
Die Asymmetrie der öffentlichen Debatte lässt sich wohl auch darauf zurückführen, dass der Bundestag öffentlichkeitswirksam über Militäreinsätze entscheidet, während andere zivile Instrumente eher im Schatten der „Parlamentsarmee“ stehen. Unabhängig davon, ob vier (Eufor RCA, Zentralafrikanische Republik) oder 850 Soldaten (Afghanistan) in einen Auslandseinsatz geschickt werden – der Bundestag entscheidet aus guten Gründen immer mit. Neben diesen Soldaten tun aber auch Hunderte von Polizeibeamten und zivilen Experten an vielen Orten der Welt ihren Dienst für Deutschland.
Eine vorausschauende Außenpolitik mit ihren zivilen Instrumenten ist dann am erfolgreichsten, wenn sie nicht die Schlagzeilen beherrscht. Wenn Krisen und Konflikte gar nicht erst aufflammen und eskalieren, dann haben die vorbeugenden Instrumente gegriffen. Zivile Krisenprävention bedeutet, vorsorgend in Frieden und Stabilität zu investieren, etwa durch die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und guter Regierungsführung, die Ausbildung von Polizei- und Sicherheitskräften oder die Stärkung der Zivilgesellschaft. 2014 war ein schweres Jahr für die Krisenprävention. An vielen Krisenherden waren wir zum reaktiven Handeln gezwungen. Doch auch im akuten Konfliktfall meinen wir es ernst mit dem Vorrang des Zivilen. So hat die Bundesregierung in der Ukraine-Krise von Beginn an deutlich gemacht: Es darf keine militärische Lösung geben. Selten hat es einen Konflikt gegeben, in dem die Bundesregierung so intensiv um eine diplomatische Lösung gerungen hat.
Der Vorrang des Zivilen steht aber nicht im Gegensatz zum sinnvollen Einsatz des Militärs. Die Nato-Mission in Mazedonien etwa sorgte 2001 dafür, dass es gar nicht erst zum Ausbruch von gewaltsamen Feindseligkeiten kam. Die Politik hat damals Mut bewiesen: Soldatinnen und Soldaten sicherten den Erfolg! Und die Stabilisierungsmission Kfor im Kosovo war bereits an dem Tag erfolgreich, als die internationale Truppe mit schwer gepanzerter Präsenz im Land komplett aufmarschiert war und jeder sehen konnte, dass das Morden vorbei sein musste. Einsatz von Militär multinational und unter UN-Mandat heißt in vielen Fällen gerade nicht: kämpfen, sondern kampfstarke Präsenz oder Abschreckung durch Stärke, um eben nicht kämpfen zu müssen. Diese Form von Konfliktprävention muss daher sichtbar sein, um Wirkung zu erzielen. Wir Deutschen neigen aber zu reflexartiger Verzagtheit. Wenn wir über Auslandsmandate diskutieren, halten wir fast schon verschämt die Zahl der eingesetzten Soldaten möglichst klein – auch aus Rücksicht auf die skeptische öffentliche Meinung. Die Gleichung – je weniger Soldaten wir zum Einsatz bringen, desto friedlicher ist unsere Außenpolitik – ist aber falsch.
Gewiss: Manche Formen von Krisenprävention z. B. Beobachter- oder Ausbildungsmissionen kommen mit weniger Personal aus. Derzeit sind vier deutsche Soldaten in der Westsahara im Einsatz, acht in Somalia, zehn in Darfur und 16 im Südsudan. Auch diese kleineren Einsätze sind weiterhin wichtig. Wir dürfen nur nicht der Illusion erliegen, dass wir uns dauerhaft auf diese Minimissionen beschränken können. Deutschland muss sich, falls nötig, auch größeren Herausforderungen stellen. Wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern in der EU, den UN oder der Nato einen substanziellen Beitrag zu Sicherung von Frieden und Sicherheit in der Welt leisten, dann müssen wir auf die gesamte Bandbreite unseres außenpolitischen Instrumentenkastens zurückgreifen können. Auch Missionen mit einer größeren Zahl von Soldatinnen und Soldaten können wir für die Zukunft nicht ausschließen. Der gesellschaftliche Konsens über das Primat des Zivilen ist in Deutschland besonders stark ausgeprägt. Umso größer ist aber auch die Versuchung, sich der unbequemen Diskussion über den möglichen Beitrag von Soldatinnen und Soldaten für eine verantwortungsvolle Friedenspolitik erst gar nicht zu stellen. Dieser Versuchung im politischen Alltag zu widerstehen – das wäre ein wichtiger Beitrag zur laufenden Debatte.
Roth (44) ist Staatsminister (SPD) für Europa im Auswärtigen Amt. Bartels (53) ist designierter Wehrbeauftragter (SPD) des Deutschen Bundestages.