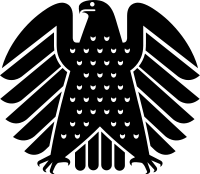Über Koalitionen wird meist in Bildern schönster Menschlichkeit gesprochen. Da heiraten zwei, lieben und zanken sich, einer spielt mit dem Gedanken, untreu zu werden, ein neuer Partner lockt, man scheidet und meidet sich, doch verliert sich nie ganz aus den Augen. Vielleicht ein ander Mal aufs Neue?
In der politischen Realität gibt es wenig, was solcher Vermenschlichung entspräche. Liebe? Treue? Trautes Glück? Unterstellt wird regelmäßig, zwei Parteien, die eine Koalition eingehen, stünden sich politisch, „inhaltlich“ besonders nah. Es gebe einen inneren Hang oder Drang zu genau dieser Vertragspartnerschaft, wohingegen andere Konstellationen aus innerer Fremdheit nicht infrage kämen.
Tatsächlich bildet jedenfalls die größte und älteste Partei Deutschlands, die SPD, derzeit Koalitionsregierungen mit allen demokratischen Parteien: mit den Grünen im Bund, in Kiel, Hamburg und – noch aktuell – in Düsseldorf; mit der PDS in Schwerin; mit der FDP in Rheinland-Pfalz; mit der CDU in Berlin, Bremen und Brandenburg. Die SPD hat auch mit bürgerinitiativartigen Gruppierungen wie der Statt-Partei in Hamburg koaliert und lässt ihre Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt durch die PDS tolerieren. Auf Bundesebene gab es die sozialdemokratische Unterschrift unter Koalitionsverträge mit der CDU/CSU (1966), mit der FDP (1969, 1972, 1976, 1980) und jetzt mit den Grünen (1998).
Auch in der Weimarer Republik ist die SPD Partner bürgerlich-demokratischer Parteien gewesen, die nach neuerer Beziehungskisten-Metaphorik wie auch nach altdeutschem Freund-Feind-Schema teilweise nur inakzeptabel sein konnten. Zentrum, DDP; bei den Präsidentschaftswahlen 1925 unterstützte die SPD im zweiten Wahlgang den Zentrums-Mann Marx gegen Hindenburg, 1932 Hindenburg gegen Hitler und Thälmann.
Ausschlaggebend ist aber erstens der tatsächliche (oder verzweifelt unterstellte) demokratische, antitotalitäre Grundkonsens. Gibt es mehr als eine Option für ein demokratisches Mehrheitsbündnis, dann kommt zweitens eine Hierarchie struktureller Kriterien zur Geltung und erst drittens die tatsächliche (oder unterstellte) „inhaltliche“ Nähe.
Strukturell gilt für Koalitionsentscheidungen nach bundesrepublikanischer Tradition grundsätzlich, dass sie zur parlamentarischen Mehrheitsbildung geeignet sein sollten. Rechtsextremisten sollten keine Gestaltungs- oder Verhinderungsmacht bekommen. Koalitionen sollten einer der beiden stärkeren Fraktionen die Oppositionsrolle überlassen und, wenn möglich, nur aus zwei statt drei oder mehr Parteien bestehen (womit dann doch wieder die zweitstärkste Fraktion als Juniorpartner gefragt sein kann). Sie sollten der Bundesratsstrategie der stärksten Koalitionspartei nicht zuwider laufen, die Koalitionsaussage vor der Wahl berücksichtigen, eine bereits vorhandene Zusammenarbeit, wenn möglich, fortsetzen und Optionen offen lassen. All dies hat mit Mehrheiten zu tun, nichts mit Liebe.
Die beiden großen Volksparteien gehen nicht deshalb so ungern eine Große Koalition ein, weil sie sich wenig zu sagen hätten, sondern vor allem aus dem strukturellen Grund, dass dann die Opposition zu schwach oder bislang kleine Parteien zu wichtig werden. Aber die SPD tut es, wenn sie die Wahl zwischen Pech und Schwefel hat. Dann wählt sie in Brandenburg die CDU als Partner einer „Elefantenhochzeit“, in Mecklenburg-Vorpommern die PDS. Und sie zeigt Verantwortungsbewusstsein in Berlin, wo sie keine Dreier-Koalition SPD/PDS/Grüne anstrebt und der CDU erspart, auf PDS oder Grüne zugehen zu müssen.
Die Union ist längst noch nicht so wie die SPD eine Partei der demokratischen Mitte, die nach allen Seiten voll koalitionsfähig wäre. Sie erlaubt sich noch keine Vertragsbündnisse mit Grünen oder PDS. Aber das wird kommen. Nichts ist in der Politik verführerischer als rechnerische Mehrheiten. Das, nicht stille Sympathie, war das Motiv des viel zitierten Brandt-Wortes (1987) von der kommenden Mehrheit diesseits der Union: Rot-Grün.
Manchmal allerdings wird der Strukturalismus sozialdemokratischer Präferenzen durchbrochen. Als in Rheinland-Pfalz Rot-Grün wie Rot-Gelb rechnerisch möglich war, siegte nach Scharpings Urteil „Inhalt“ über das Kalkül der zuverlässigen Bundesratsmehrheit gegen die Kohl-Regierung. Und in Bremen durfte nach der vorletzten Bürgerschaftswahl die ganze SPD per Urwahl zur freien Entscheidung antreten. Es siegte Rot-Schwarz über Rot-Grün – knapp und überraschend, denn bei professionellen Beobachtern steht die SPD im Ruf, den Grünen politisch am nächsten zu stehen.
Was bedeutet all dies für Düsseldorf? Es bleibt bei Rot-Grün. Und die FDP? Das Beste an einer Option, sagt Gerhard Schröder, ist, dass man sie hat. Liebe ist da nicht im Spiel.