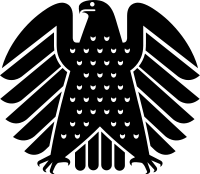SPIEGEL ONLINE: Die Regierung ist gerade sehr interessiert an Ihrem Konzept der freiwilligen Wehrpflicht. Fühlen Sie sich geschmeichelt?
Bartels: Wenn ich jetzt sagen würde: Ja, damit überhaupt mal etwas klappt, muss die Regierung vernünftige SPD-Konzepte übernehmen, dann würden die Unionskollegen wahrscheinlich sofort wieder anfangen, sich etwas Unvernünftiges auszudenken. Aber im Ernst: Hier ist für eine richtige Idee offenbar die Zeit gekommen! Wir sagen: Pflicht so weit wie nötig – Freiwilligkeit so weit wie möglich. Und da ist in heutiger Zeit viel mehr möglich.
SPIEGEL ONLINE: Das Konzept klingt allerdings ein bisschen widersprüchlich. Eine freiwillige Pflicht. Wie soll das gehen?
Bartels: Die Bundeswehr braucht heute nicht mehr einen ganzen Jahrgang, sondern von 400.000 jungen Männern vielleicht künftig noch 40.000 jedes Jahr – als Zeitsoldaten und als Wehrpflichtige. Wir wollen an Erfassung und Musterung festhalten, aber in Zukunft die tauglich Gemusterten fragen, ob sie zur Bundeswehr wollen. Niemand muss gegen seinen Willen einberufen werden. Schon heute haben wir ja jährlich 20.000 Freiwillige als Zeitsoldaten und 20.000 freiwillig länger Wehrdienst Leistende, die sogenannten FWDLer. Die Rechnung geht auf. Aber für den Fall, dass sie einmal dramatisch nicht aufginge, hätten wir die Rückversicherung des Pflichtdienstes. So muss Sicherheitspolitik denken.
SPIEGEL ONLINE: Schaffen Sie die Wehrpflicht damit nicht faktisch ab?
Bartels: Nein. Nach unserem Modell gibt es weiterhin eine gewisse Anzahl von Wehrdienstleistenden, die für einen flexiblen Zeitraum von zwölf bis 23 Monaten zur Truppe kämen, freiwillig, aber nicht per Stellenanzeige, sondern nach der Musterung einberufen aus dem gesamten breiten Spektrum eines Jahrgangs. Aus manchen von diesen werden vielleicht später Zeit- und Berufssoldaten. Dann wäre übrigens auch Schluss mit Untauglichkeitsquoten von beinahe 50 Prozent, die deshalb so absurd hoch sind, weil einfach nicht so viele Rekruten gebraucht werden. Nicht die Hälfte unseres Nachwuchses ist krank, sondern dieses Verfahren.
SPIEGEL ONLINE: Warum wollen Sie denn unbedingt an der Wehrpflicht festhalten. Unsere Nachbarn in Europa haben sie fast alle abgeschafft?
Bartels: Glücklich sind diese Nachbarn damit nicht! Viele leiden unter Quantitäts- und Qualitätsproblemen, weil sie ihr Personal über den allgemeinen Arbeitsmarkt gewinnen müssen. Damit werden sie abhängig vom demografischen Wandel und von der Konjunktur. Der Vorteil der künftigen Wehrpflicht ist, dass jeder junge Mann erreicht und um seine Entscheidung gebeten wird. Das ist etwas anderes, als wenn man in bestimmten Zielgruppen mit Straferlass oder Einbürgerung lockt, wie einige Nato-Partner dies inzwischen tun müssen.
SPIEGEL ONLINE: Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg will die Bundeswehr drastisch verkleinern. Ist das sicherheitspolitisch angemessen?
Bartels: Ich weiß nicht, was Guttenberg will. Mal sagt er dies, mal sagt er das. Aber natürlich können unsere Streitkräfte einen Sparbeitrag leisten: Sie sind noch zu stabslastig, sie können auf teure Jobs wie die nukleare Teilhabe verzichten, sie können durch den Übergang zum freiwilligen Wehrdienst Personal und Geld sparen. Die jüngste schwarz-gelbe Erfindung eines W6-„Praktikums“ jedenfalls kostet zusätzlich und spart nichts. Es gibt in der Bundeswehr aber auch Mängelanzeigen: zu wenig infanteristische Kräfte, zu schlechte Bezahlung in wichtigen Bereichen, zu altes Gerät etwa im Lufttransport.
SPIEGEL ONLINE: Ziel der geplanten Reformen ist auch, aus der Bundeswehr eine kleine effiziente Einsatzarmee zu machen. Warum brauchen wir so etwas? Vielen Ihrer Parteigenossen scheint es schon wenig einleuchtend zu sein, die deutsche Sicherheit am Hindukusch zu verteidigen.
Bartels: Eine reine Expeditionsarmee, die allein auf Missionen wie in Afghanistan ausgelegt ist, wäre mit uns nicht zu machen. Die Bundeswehr ist seit Ende des Kalten Krieges schon von 500.000 auf 250.000 Soldaten halbiert worden. Jetzt kann man nicht noch einmal 100.000 Stellen streichen. Wir brauchen schon eine gewisse Größe und Struktur als Beitrag zur Bündnissicherheit in Europa. Manche unserer Partner haben nicht so nette Nachbarn wie wir selbst inzwischen.
Das Interview führte Ulrike Demmer
SPIEGELonline, erschienen am 27. Juli 2010