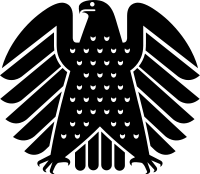Die Vorlage des Vorstandes war rechtzeitig verschickt worden, im Umfang knapp, inhaltlich absolut präzise, alle Linien klar erkennbar. Es war ein Plan der Fraktion, genauer gesagt: die Tischordnung im Sitzungssaal der SPD-Fraktion.
Eine so große Parlamentsfraktion hatte die SPD noch nirgends und niemals zu ordnen, in keinem Land, nicht im Reichstag, nicht im Bundestag: 298 sozialdemokratische Abgeordnete – das dürfte auch weltweit Spitze sein, denn in den wenigen (Schein-)Parlamenten, die größer sind als der 669köpfige Bundestag des wiedervereinigten Deutschlands (China 2.921 Abgeordnete, Libyen 750, Nord-Korea 687), gibt es keine Sozialdemokraten.
Man sitzt nach Landesgruppen. Die Fraktionsführung verteilt die Tische, die Landesgruppe weist die Stühle zu. Soweit Stühle freigeworden sind. In Schleswig-Holstein sind zwei Stühle freigeworden, aber drei neugewählte Abgeordnete sind zu setzen. Schleswig-Holstein besetzt, von vorne gesehen, immer den Tisch in der hinteren rechten Ecke des Saales. Jedenfalls in den letzten 16 Jahren war das so, sagt einer, der seit 16 Jahren dabei ist. Nun muß ein Stuhl dazugestellt werden.
Geordnetes Sitzen ist wichtig. Bei so viel gleichzeitigem Neuen wie jetzt, bei so vielen neuen Gesichtern, bei so viel Enge und Gedränge in Bonns Neuer Mitte schafft ein rechtmäßig zugeteilter Platz ein Minimum an Sicherheit. Die Alternative zur herrschenden Fraktionssitzordnung wäre Durcheinander, Anarchie. Oder Fraktioniererei, Fraktionssitzungen würden vielleicht anders verlaufen, wenn sich in der einen Ecke die „Rechten“ und in der anderen die „Linken“ zusammenrotten könnten oder hier die 210 „Alten“ und da die 88 „Neuen“ oder an einem Tisch die Ökologen, an einem anderen die Wirtschaftspolitiker. Das Sitzen nach Landesgruppen dagegen ist politisch neutral, wie es sich gehört: vorn Vorstand, Kanzler und Parteivorsitzender, ihnen gegenüber im Saal knapp 300 einzelne Abgeordnete.
Außerhalb des überfüllten, aber nun wie eh und je planvoll eingeteilten Sitzungssaales F12 ordnet sich derweil die sozialdemokratische Welt neu. Waren es bisher Landesfürsten der „Enkel“-Generation, die – mit Sitz im SPD-Präsidium – von ihren Staatskanzleien aus die Partei steuerten, so ist seit dem 27. Okober 1998, dem Tag der Kanzlerwahl, der sozialdemokratische Teil der Bundesregierung zum politischen Zentrum der Partei geworden: Da ist der ehemalige Ministerpräsident, Kanzlerkandidat und jetzt Bundeskanzler Gerhard Schröder, dazu der ehemalige Ministerpräsident, Kanzlerkandidat und jetzige Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine sowie der ehemalige Ministerpräsident, Kanzlerkandidat, Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende und jetzt Vorsitzende der europäischen Sozialdemokraten und Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Fehlte noch der frühere Ministerpräsident, Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende Björn Engholm, der aber aus bekannten Gründen nicht mehr aktiv ist. Ein mächtigeres SPD-Zentrum in der Regierung wäre derzeit nicht denkbar.
Das bisher so starke Off-Bonn-Länder-Establishment verliert damit an innerparteilichem Einfluß. Die elf sozialdemokratischen Ministerpräsidenten sehen sich nun einer SPD-geführten Bundesregierung gegenüber, die zugleich den Ton im Parteivorstand angibt. Von den elf sind außerdem vier erst 1998 ins Amt gekommen (Clement, Ringstorff, Klimmt, Glogowski), die drei bisher wichtigsten sind aus diesem Kreis ausgeschieden (Rau, Schröder, Lafontaine). Sieben sozialdemokratische Regierungschefs bleiben auf ihren Posten in der Provinz, was für manche eine Enttäuschung langgehegter Einflußwünsche bedeutet. Halb zieht es sie, halb sinken sie hin: Sie werden zu einer Art konstitutioneller Opposition innerhalb des Regierungslagers. Wolfgang Clement hat auf den Punkt gebracht, was im föderalen Staat für alle gilt: Erst kommen Landesinteressen, dann die Partei. Und an Selbstbewußtsein fehlt es dieser immer noch schmucken Riege von arrivierten Hoffnungsträgern nicht – nur daß die mit ihnen verbundenen sozialdemokratischen Hoffnungen sich jetzt darauf beschränken, die Macht an der Peripherie zu verteidigen, das heißt, den Wiederaufstieg der CDU über die Länder aufzuhalten.
Ganz neu sortiert sich im Innern die Bundestagsfraktion, die aber nach außen, im Verhältnis zu den anderen SPD-Gewalten, bleibt, was sie war: ein zweitrangiges Machtzentrum. Die alte Fraktionsführung sitzt nun als Minister auf der Regierungsseite (Scharping, Schily, Wieczorek-Zeul, Schwanitz) oder in leitenden Partei- (Schreiner) oder Parlamentsfunktionen (Thierse, Fuchs), was der bisherigen zweiten und dritten Reihe langgedienter Fraktionsmitglieder die Chance gibt, in die freiwerdenden Vorstandspositionen nachzurücken. Es dürfte jedenfalls eine Weile dauern, bis die neuen Fraktionsfunktionäre ihren Vorgängern als gleichrangig erscheinen werden.
Vieles ist neu im Bonn der regierenden Sozialdemokratie. Fast jeder, der nun wichtig ist, hat ein neues Amt oder jedenfalls eine andere Position im parteiinternen Machtgefüge. Die bis zum Abschluß des Koalitionsvertrages so geschmiert laufende sozialdemokratische Wahlkampfmaschine existiert nicht mehr. Die neu positionierten Sozialdemokraten müssen, auch wenn sie einander schon seit Juso-Ewigkeiten kennen, sich erst neu aufeinander einstellen, lernen, wer mit wem zu telefonieren hat, wenn man offene Briefe vermeiden will.
Dann werden irgendwann Gesetzentwürfe nicht mehr als Tischvorlage in die Fraktion gereicht, die SPD-Regierungsmitglieder werden außerhalb des Kabinetts mit einer Stimme sprechen, und die neueste Linie zum megakomplexen Problem der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse wird dann nicht mehr erst über einen Debattenbeitrag des Richtlinienkanzlers in der Aktuellen Stunde des Bundestages ausgegeben.
Nach derart geordneten Verhältnissen zu streben gehört zum Wesen der Sozialdemokratischen Partei seit 135 Jahren.
Die rechtzeitig verschickte Vorlage über die Sitzordnung in der Bundestagsfraktion wurde ohne Diskussion zur Kenntnis genommen und gilt nun so.