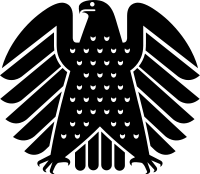Reform! Reform! In Zeiten des Bildungsnotstandes wird jeder Ladenhüter feilgeboten, um die Pisa-Probleme zu lösen und Deutschland zu retten. Dabei ist das Problem unseres Schulwesens auch bisher nicht der Mangel an progressiven Reformspielereien gewesen, sondern gerade der Dauerreformstress. Die „reformierte Oberstufe“ der Gymnasien etwa wird seit drei Jahrzehnten alle paar Jahre nach der neuesten Mode von Grund auf umgebaut. Mit welchem Erfolg? Ein kritischer Blick zurück kann insbesondere der Linken also nicht schaden.
Die große sozialdemokratische Bildungsoffensive seit den sechziger Jahren hatte vor allem zwei Ziele: Chancengleichheit für sozial benachteiligte Kinder und internationale Wettbewerbsfähigkeit auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet.
Quantitativ waren die Reformen ein ungeheurer Erfolg: Der Anteil der Abiturienten ist von sieben auf heute rund 30 Prozent gestiegen. Schulen und Hochschulen sind auch von entlegenen Standorten im ländlichen Raum aus gut zu erreichen. Das Bildungssystem ist durchlässig: Auch „Spätentwickler“ haben viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich höhere Bildungsabschlüsse auch auf Nebenpfaden und Umwegen anzueignen. Das sind große Erfolge. Die Pisa-Studie zeigt nun aber Defizite und Versäumnisse auf. Sie zwingen dazu, die eigenen Prämissen – und das kann schmerzhaft sein – selbstkritisch zu beleuchten.
In der alten Bildungsrhetorik spielten die „Paukschule“ und der „Frontalunterricht“ eine große Rolle. Von diesem liebgewonnenen Feindbild müssen wir uns dringend verabschieden: Es entspricht in keiner Weise mehr der Realität in den Schulen. Dreißig Jahre antiautoritär inspirierte Dauerreform haben vielmehr für die weitest mögliche Entgrenzung, Entformalisierung und Entkanonisierung der Schulpraxis gesorgt. Darin, nicht im vermeintlich autoritären Auftreten der Lehrer, liegt heute das Problem.
Chancengleichheit hängt heute vor allem davon ab, was ein Mensch wirklich gelernt und verstanden hat. Freundlich formulierte Zertifikate, hinter denen sich Analphabetismus oder Halbwissen verbergen, nützen ihren Inhabern nichts. Deshalb müssen wir – statt fruchtloser Methodendiskussion – hart darüber diskutieren, was gelernt werden soll.
Nicht alle Unterrichtsfächer sind gleich wichtig. Es gibt zentrale Inhalte, die für die Entwicklung eines eigenen Urteilsvermögens unabdingbar sind: vor allem die gründliche, anschauliche Vermittlung unserer Geschichte und die umfassende Beschäftigung mit unserer Sprache und Literatur. Woher wir kommen, wie wir denken und sprechen, das sind die Fragen, die allem anderen vorangehen. Schüler sollen auch Fremdsprachen lernen, gewiss; und mathematische Grundlagen und die Benutzung eines Computers und die Voraussetzungen, um eines Tages Biotechnologie studieren zu können. Aber gute Naturwissenschaftler, Informatiker und Mediziner, ebenso wie gute Rechtsanwälte, Unternehmensberater oder Ingenieure können sie nur werden, wenn sie ein solides Gefühl für unsere Geschichte und unsere Kultur entwickeln durften. Diese Einsicht sollte Anlass für eine gründliche Kanondebatte sein – und Skepsis gegenüber allen auf den Arbeitsmarkt fixierten Reformgedanken wecken.
Bessere, umfassendere formale Bildung für alle lässt sich nicht erreichen, indem man den Lehrern hier und da eine Stunde Mehrarbeit aufbürdet. Auch die Eltern tragen Verantwortung für den Unterricht: Sie müssen dafür sorgen, dass ihr Kind ausgeschlafen ist; dass es vernünftig ernährt wird; dass es lernt, sich zu konzentrieren und sich ruhig und aufmerksam einem Gegenstand zu widmen; dass man Konflikte nicht mit Gewalt löst. Diese Erziehungsaufgaben gehören vor allem ins Elternhaus, nur in zweiter Linie in die Schule. Ganztagsschulen und -kindergärten können die Bemühungen der Eltern ergänzen, nicht ersetzen. Die Erziehung von Kindern bleibt vor allem eine private, sie wird auch in Zukunft keine staatliche Aufgabe sein.
In dem Versuch, modern zu erscheinen, überschlagen sich sozialdemokratische wie konservative Bildungspolitiker in Beschleunigungsappellen: Computerkurse im Kindergarten, Englisch in der Grundschule, Abitur nach 12 Jahren, Studium (gern im Ausland) in acht Semestern! Geschwindigkeit wird zu einer neuen Ideologie im Bildungswesen. Tatsächlich spricht nichts dagegen, sinnlose und zeitraubende Formen der Studienorganisation zu bekämpfen. Insgesamt aber gilt: Kinder und Jugendliche lernen nicht allein für die Bedürfnisse eines sich stetig verändernden Arbeitsmarktes. Gerade weil dessen Anforderungen sich wandeln, brauchen sie Zeit für eine gründliche Bildung, Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Eine neue Kultur des „lebenslangen Lernens“ kann diese Phase ergänzen, aber niemals ersetzen.