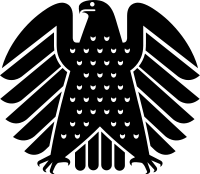Welche sicherheits- und bündnispolitischen Konsequenzen ergeben sich aus der Krise um die Ukraine?
Der Westen bemüht sich sehr, den Konflikt zu deeskalieren. Das heißt: internationale Gremien nutzen, Gespräche mit allen Seiten organisieren, keine substantial combat forces der Nato in den Osten verlegen, Russland den Rückweg offenhalten. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg. Gleichwohl muss Russland gegenüber aber auch unmissverständlich klar sein, dass Europa und die Nato die Drohgebärden nicht akzeptieren. Und dass unsere östlichen Nato-Partner sicher sind. Das geschieht. Konventionelle Abschreckungswirkung des Bündnisses in Europa ist ein Thema, das wir gern hinter uns gelassen hätten. Aber es ist wieder da.
Nach der Wende haben globale Kriseneinsätze der NATO und EU die Struktur und Ausrüstung der Bundeswehr bestimmt. Müssen wir uns in Zukunft wieder stärker der Landes- und Bündnisverteidigung zuwenden?
Mit russischer Konfrontationspolitik und Militärintervention zu Grenzveränderung und Annexion hatte im Bündnis ernsthaft kaum noch jemand gerechnet. Jetzt wird neu interpretiert, was sich seit Jahren – im Nachhinein betrachtet – angebahnt hat: die drastische Aufstockung des russischen Militärbudgets, die Modernisierung der Streitkräfte, die neue Militärdoktrin, Putins Reden über den Westen als möglichen Gegner und die Auflösung der Sowjetunion als “größte Katastrophe” des 20. Jahrhunderts, der Einmarsch in Georgien, die Manöver zum Durchstoßen an die Ostsee und Übungen zum Atomwaffeneinsatz in Polen.
Militärische Planspiele müssen noch keine politischen Pläne sein. Aber klar ist in Brüssel heute, dass die Krimkrise vieles verändert und Vertrauen zerstört hat. Die offene Frage, die Militärs und Diplomaten dort vor dem Nato-Gipfel Anfang September 2014 in Wales umtreibt, lautet: War’s das? Oder bleibt Putins imperialer Ausbruch des Jahres 2014 eine Episode? Kommt er zurück auf das europäische Terrain der Vertragsdiplomatie, des Ausgleichs der Interessen, der wirtschaftlichen Verflechtung und auch der sicherheitspolitischen Kooperation? Niemand setzt sich dafür – aus guten historischen Gründen – stärker ein als die deutsche Bundesregierung. Gelänge diese Rückkehr zur Partnerschaft nicht, wären die Folgen für Russland, Europa und die Welt unabsehbar.
Welche Notwendigkeit sehen Sie für eine verstärkte militärische und rüstungswirtschaftliche Kooperation in Europa, und welche Perspektiven ergeben sich aus der gegenwärtigen Lage für eine Europäische Armee?
Auf dem Weg zu gemeinsamen Streitkräften bleiben viele Fragen zu klären. Noch gibt es in Europa wesentliche strukturelle Unterschiede, etwa in der Wehrform, der Parlamentsbeteiligung oder dem System der Führung. Die SPD strebt langfristig eine europäische Armee an. Dieses Ziel wurde auch im Koalitionsvertrag mit CDU und CSU festgeschrieben. Wollen wir unser Ziel erreichen, sollten wir sofort damit beginnen, uns mit unseren Partnern in Europa besser abzustimmen. Ein europäisches Weißbuch wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer wirklich gemeinsamen Streitkräfteplanung.
Darüber hinaus muss angesichts knapper Mittel in fast allen europäischen Verteidigungshaushalten der Effizienzgedanke eine viel stärkere Rolle spielen. Die 28 Länder der EU geben 190 Milliarden Euro für Verteidigung aus und unterhalten mehr als 1,5 Millionen Soldaten. Das ist für jeden denkbaren Zweck eigentlich genug. Die Zusammenarbeit des niederländischen Heeres mit dem deutschen Heer ist hier absolut richtungsweisend! Wie müssen Fakten schaffen. Ich würde nicht gern darauf warten, bis sich alle EU-Mitglieder auf ein detailliertes Gesamtkonzept geeinigt haben, sondern setze auf die normative Kraft des Faktischen. Auf der politischen Ebene brauchen wir einen europäischen Verteidigungskommissar, einen Verteidigungsausschuss des Europäischen Parlaments, einen Verteidigungsministerrat und ein ständiges EU-Hauptquartier, welches über ausreichende personelle und materielle Ausstattung verfügt, um auch wirklich planen und führen zu können. Der Lissabon-Vertrag steht dem nicht entgegen. Es reichen neun Länder um hier gemeinsam voranzugehen.
Erfüllt die Neuausrichtung der Bundeswehr die zukünftigen Anforderungen im Bündnis und hat sie eine europäische Perspektive?
In allen Einsätzen arbeiten wir bereits multinational, im Friedenbetrieb aber noch nicht. Das ändert sich jetzt langsam. Anfang Juni wurde die niederländische luftbewegliche Brigade der deutschen Division Schnelle Kräfte unterstellt. Ebenso sollten wir deutsche Teilfähigkeiten bei anderen Nationen „anlehnen“, etwa amphibische Kräfte bei Niederländern, Dänen oder Briten. Für dieses Zusammenarbeitsmuster ist es wichtig, dass heute die nationalen Streitkräfte, auch unsere, erkennbare Schwerpunkte setzen. Die Maxime „Breite vor Tiefe“ gehört der Vergangenheit an. Stärken der Bundeswehr wären etwa: gepanzerte Kräfte, Luftbeweglichkeit, bodengebundene Luftabwehr, Sanität, U-Boote, Führungsfähigkeit. An solchen deutschen militärischen Kernfähigkeiten könnte sich dann auch unsere Industrie orientieren.
Wie kann der Auftrag und die gesellschaftliche Rolle der Bundeswehr als Parlamentsarmee stärker im Bewusstsein unserer Bevölkerung verankert werden?
Hier gibt es aus meiner Sicht großen Handlungsbedarf. Nicht mit Blick auf die Bundeswehr als Parlamentsarmee. Das funktioniert gut. Vielmehr geht es um unsere Sicherheitspolitik im Ganzen. Ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland regelmäßig, z.B. alle vier Jahre ausgehend vom Bundestag über Deutschlands Beiträge zu Krisenbewältigung, Konfliktprävention und Bündnispolitik sowie der Friedensverantwortung der Vereinten Nationen diskutieren würden. Die Bundesregierung müsste dazu jeweils eine strategische Positionsbestimmung vorlegen.
Im Bericht des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein 2012 haben Sie zur Reform der Bundeswehr geschrieben: „Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen: Wir werden bald Nachbesserungen erleben“. Wo sehen Sie heute in der Struktur und Ausrüstung Handlungsbedarf?
Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt: keine weitere große Bundeswehrreform! Die neue Struktur muss nun wirklich eingenommen werden. Es gab ja seit 1990 mehr „Neuausrichtungen von Grund auf“, als der Bundeswehr gut tat. Aber wir werden uns einzelne Punkte noch einmal anschauen und wo nötig nachsteuern. Dabei wird es etwa um Strukturentscheidungen gehen, die von noch offenen Rüstungsfragen abhängig sind.
Beispiel Eurofighter: Nachdem nun klar ist, dass wir die Tranche 3B, also die letzten 37 Stück nicht nehmen, bleibt zu entscheiden, was mit den Einrollen-Jägern der Tranche 1 wird. Haben wir am Ende drei Eurofighter-Geschwader mit der Gesamtzahl von 108 Flugzeugen? Machen wir dann die Ausbildung in Deutschland oder in Amerika? Anderes Beispiel: Was geschieht mit den bestellten, aber in der neuen Struktur nicht abgebildeten Hubschraubern? Das betrifft nicht nur NH90 und Tiger. Es gibt aus der Bundeswehr heraus schon Anpassungsüberlegungen hinsichtlich CH53. Meine Meinung ist, wir brauchen für alle denkbaren UN-, NATO- und EU-Missionen eher mehr als weniger Hubschrauber.
Also: Auch bei der Ausrüstung Schwerpunkte setzen, am besten europäisch abgestimmt. Das Beschaffungswesen im Ministerium und in Koblenz muss dafür wieder handlungsfähig werden. Wir brauchen außerdem Signale für die Neuanfänger-Projekte der Zukunft, Beispiel MKS 180, Nachfolge Leo 2, erweiterte Luftabwehrfähigkeit, Aufklärungsdrohnen.
Wo sehen Sie Notwendigkeiten und Erfolgsaussichten für Nachbesserungen im Standortkonzept in Schleswig-Holstein?
Ohne falsche Erwartungen zu wecken: Es geht um den Erhalt wehrtechnischer ziviler Dienststellen der Bundeswehr mit wissenschaftlichen Anteil, immer um eine Konsolidierung der Marine um Kiel und Eckernförde herum, um die längstmögliche Nutzung von Hohn für den Restflugbetrieb Transall und neue UAVs für Jagel.
Sehen Sie Chancen, den neuen deutschen Beschaffungsprozess auch auf europäischer Ebene durchzusetzen, und wie bewerten Sie die Rolle der Europäischen Rüstungsagentur EDA bei der Standardisierung von Verfahren und Ausrüstungsvorhaben?
Fast alle größeren laufenden Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr sind multinationale Projekte. Dennoch bleiben erhebliche Effizienzreserven. Europäisch abgestimmte Normen und Zulassungsverfahren sowie größere Beschaffungsmengen können einen Beitrag zur Kostensenkung, aber auch zur Interoperabilität der europäischen Streitkräfte leisten. Wir haben in Europa zu viele Jagdbomberprogramme, zu viele Fregattenprogramme und zu viele Miniserien geschützter Fahrzeugtypen.
Nach meiner Auffassung können die EU-Nationen erst konkrete gemeinsame Ausrüstungs- und Beschaffungsvorhaben der Europäischen Verteidigungsagentur EDA zur Planung übertragen, wenn der politische Überbau da ist: Verteidigungsministerrat, -kommissar, -ausschuss und das Hauptquartier. Die EDA ist jetzt kaum mehr als ein Forschungsgelderzentrum. Sie könnte viel mehr sein!
Wie bewerten Sie die Leistungsfähigkeit der Wehrtechnik-Unternehmen in Schleswig-Holstein und ihre nationale und internationale Wettbewerbssituation?
Ausweislich Ihrer verdienstvollen Jahresberichte sind die wehrtechnischen Unternehmen in Schleswig-Holstein gut aufgestellt, sowohl was Qualität und Zuverlässigkeit angeht, als auch was die Auslastung betrifft – jedenfalls überwiegend. Und noch. Darüber freue ich mich.
Die wehrtechnische Industrie beklagt die im Vergleich zu den Bündnispartnern restriktiven deutschen Rüstungsexportbestimmungen. Wie bewerten Sie die Chancen für eine Harmonisierung auf europäischer Ebene?
Die deutschen „politischen Grundsätze“ sind gut. Allerdings war die Praxis in den letzten vier Jahren nicht immer so restriktiv, wie sie auf dem Papier steht. Natürlich gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, sondern alle Schattierungen dazwischen – immer gute Argumente für oder gegen Genehmigungen für dieses oder jenes Land zu diesem oder jenem Zeitpunkt. Und leider haben wir in der Europäischen Union keine Übereinstimmung in der Genehmigungspraxis. Das sollten wir ändern. Wir können allerdings die anderen nicht zwingen. Was sich für den Bundestag erst einmal ändert, ist die Unterrichtung durch die Bundesregierung. So wird künftig der Rüstungsexportbericht zweimal statt einmal jährlich vorgelegt werden, und bei größeren im Bundessicherheitsrat positiv beschiedenen Projekten wird das Parlament unmittelbar unterrichtet. Damit entfällt die Geheimniskrämerei – und die Basis für das unwürdige Spekulieren, was das Gremium denn nun gerade beschlossen hat.
Unser Koalitionsvertrag bekennt sich zur politischen Verantwortung für die deutsche wehrtechnische Industrie. Aber Veränderungen könnten nötig werden, um Arbeitsplätze und technologisches Know How zu sichern: Ich glaube, dass manche Systemhäuser in Deutschland für den Wettbewerb zu klein sind, um zu überleben. Wer existenziell von einem einzelnen Exportauftrag aus einem einzelnen schwierigen Land abhängig ist, ist zu klein. Die Schlüsse daraus muss die Industrie selbst ziehen. Aber unsere Politik kann unterstützen, wie Gerhard Schröder das im Jahr 2000 schon einmal versucht hat. Vielleicht zu früh. Heute ist es definitiv nicht mehr zu früh für eine nationale Konsolidierung als Vorbedingung für die Bildung europäischer Champions.