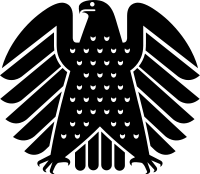Manche in der SPD, die es gut mit Olaf Scholz meinen, und andere, die weniger freundlich sind, witzeln über den Generalsekretär, er hätte den „demokratischen Sozialismus“ schon immer abschaffen wollen – früher, als dogmatischer Jungsozialist, weil „Demokratie“ eine Anti-Dogmatiker-Parole war, und heute, weil er ein SPD-Programm schreiben soll und sich immer noch nichts Rechtes unter diesem Sozialismus-Begriff vorstellen kann. Aber darum darf es im Ernst nicht gehen. Sozialismus ist heute ein Nebenkriegsschauplatz. In der Hauptsache geht es um neue Orientierung – für eine Partei, die das größte Land Europas regiert und zunehmend nervös wird, weil die Wirtschaft nicht wachsen will, der Wohlstand stagniert, die Schulden wieder steigen und das Transferniveau des Sozialstaates sinkt. Umfragen sehen die noch 2002 siegreiche SPD bundesweit unter 30 Prozent. Und 2004 drohen vierzehn Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen.
Was der Sozialdemokratie in dieser Situation mehr fehlt als zu den guten alten Oppositionszeiten, da man sich an Helmut Kohl abarbeiten und vor dem Neoliberalismus warnen konnte, ist tatsächlich ein verbindliches, aktuell gültiges Grundsatzprogramm – die klare Linie, der rote Faden. Das sagen inzwischen fast alle Parteimitglieder auf allen Ebenen. Die SPD ist eine Programmpartei, die programmatische Unsicherheit nicht gut ertragen kann.
Deshalb hat der Parteitag im Dezember 1999 ein neues Grundsatzprogramm in Auftrag gegeben. Es wäre das achte in 140 Jahren Sozialdemokratie – nach Eisenach (1869), Gotha (1875), Erfurt (1891), Görlitz (1921), Heidelberg (1925), Bad Godesberg (1959) und Berlin (1989).
Es wird eine nachholende Programmdiskussion, denn das letzte, das „Berliner Programm“ war schon nicht mehr aktuell, als es im Dezember 1989 beschlossen wurde, in einem historischen Moment, als sich gerade die ganze Welt änderte. So ist es – jahrelang gründlich vorbereitet – das sozialdemokratische Schlussdokument der westdeutschen Bundesrepublik geworden. Es formuliert das progressive Selbstverständnis seiner Zeit, der siebziger und achtziger Jahre. Das Staats- und Gesellschaftsbild ist sehr institutionenskeptisch, zum Teil betont antiautoritär. Anknüpfend an den damaligen Aufschwung der neuen sozialen Bewegungen ist der Text geprägt von Befindlichkeitsrethorik: von der Furcht vor großen Kriegen, vor großer Technik, vor der Öko-Apokalypse. Die Rangfolge der Themen lautet: Frieden, Ökologie, soziale Gerechtigkeit. Und soziale Gerechtigkeit begann damals, politisch sehr korrekt, mit dem Ausgleich zwischen Nord und Süd.
Symbolisch für diese gesinnungsstarke SPD, die mit aller Welt solidarisch sein wollte und im eigenen Land weit entfernt war von der Macht, mag das offizielle Parteilied vom „Weichen Wasser“ stehen, das damals gesungen wurde (Text und Musik: Dieter Dehm – zur damaligen Zeit noch SPD-Mitglied). Der Refrain lautet:
Und sind wir schwach, und sind wir klein, wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein.
Seit 1989 hat sich vieles verändert. Die Themenrangfolge sieht heute anders aus. Und das wiedervereinigte Deutschland hat seit zehn Jahren auch ein paar neue Probleme – Probleme, die wir uns eigentlich immer gewünscht haben.
Warum wurde da nicht gleich ein neues, der neuen Zeit gemäßes Programm in Angriff genommen? Vielleicht weil die SPD die ganzen 90er Jahre über zu sehr beschäftigt war mit Personalpolitik, mit den internen Ausscheidungskämpfen der „Enkel“-Elite. In diesen Jahren sind Oskar Lafontaine, Björn Engholm, Rudolf Scharping und Gerhard Schröder jeweils zu Kanzlerkandidaten nominiert und jeweils zu Parteivorsitzenden gewählt worden. Vier Brandt-Nachfolger, zwei Ämter, acht Personalentscheidungen, die jeweils die ganze Republik bewegten. Das ist nun längst durchgestanden, der Regierungswechsel hat endlich stattgefunden, und die innerparteiliche Konkurrenz ist zu einem guten Ende gekommen. Gerhard Schröder ist heute der am längsten amtierende Parteivorsitzende der Nach-Brandt-Ära und, nach Helmut Schmidt, der am längsten amtierende SPD-Kanzler aller Zeiten. Jetzt, in der Regierungsverantwortung, soll Zeit sein für Programmarbeit.
Einige wichtige Stichworte, die heute zentral sind, tauchen in dem Berliner Programm noch gar nicht auf, zum Beispiel: Staatsverschuldung, Generationengerechtigkeit oder auch nur UNO-Blauhelme, geschweige denn eine (EU-)europäische Interventionstruppe, wie sie jetzt geplant ist. Aufgabe des neuen Grundsatzprogramms wird es sein, überhaupt erst einmal den Anschluss an die Wirklichkeit wiederherzustellen. Tatsächlich ist – bei allen Schwierigkeiten – die Regierungs-SPD der Programm-SPD im Augenblick weit voraus. Es müsste umgekehrt sein.
Die rationale Methode zur Erarbeitung einer fortschrittlichen Programmatik sollte dabei weniger ein dogmatischer Deduktionismus sein, wie in der Vergangenheit, als vielmehr ein kritischer Empirismus. Auch der spektakuläre Wechsel von einer deduktionistischen Ideologie zur anderen, von der jungsozialistischen Verstaatlichungs-Vergötzung zur Anbetung einer radikalen Privatisierungsstrategie, vom doktrinären Bindestrich-Sozialismus zum doktrinären Liberalismus macht nicht alles gut. Er zeigt nur, wie beliebig die Unbedingtheit von individuellen politischen Bekenntnissen sein kann. Die Moden wechseln. Für Sozialdemokraten gilt, wie Karl Popper formuliert hat, „das Prinzip, dass der Kampf gegen vermeidbares Elend ein anerkanntes Ziel der staatlichen Politik sein sollte, während die Steigerung des Glücks in erster Linie der Privatinitiative überlassen bleiben sollte.“ Die Balance wäre unter sich wandelnden Umständen immer wieder neu zu organisieren. Sozialdemokraten wissen, dass es keine vollkommene menschliche Einrichtung gibt, keinen vollkommenen Markt, kein perfektes Regierungssystem, keinen allmächtigen guten Staat, keine vollkommene Gesellschaft. Wir Menschen sind aus krummem Holz gemacht. Politik ist nicht alles, doch ihr Primat demokratischer Selbstbestimmung gilt gegenüber allen scheinbaren Sachzwängen technischer oder ökonomischer Rationalität, gegenüber religiösem Fanatismus und dem angemaßten Recht des Stärkeren.
Kräfte des Wandels
Unsere Zeit steckt, mit einem Wort von Willy Brandt, der über ein Vierteljahrhundert die SPD geführt hat, voller Möglichkeiten – zum Guten wie zum Bösen. Brandt selbst, vor Beginn des Ersten Weltkrieges geboren, erlebte das Scheitern der Weimarer Demokratie, die nationalsozialistische Terrorherrschaft, Verfolgung und Exil, den Zweiten Weltkrieg, den sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Wiederaufbau im Westen und die kommunistische Diktatur im Osten Berlins, Deutschlands und Europas, den Kalten Krieg und dessen Ende, die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands, den Beginn der Einigung ganz Europas – und zugleich die Vertiefung der Teilung unserer Welt in Arm und Reich, Hoffnungslosigkeit und Überfluß.
Die Zeiten ändern sich. Sie ändern sich mit und ohne unser Zutun. Aber Sozialdemokraten wollen den Wandel gestalten. Um welche Wandlungen der Gesellschaft geht es? Es sind vier große Bewegungen, die am Anfang des 21. Jahrhunderts wichtig und mächtig erscheinen: erstens, die altbekannte Antriebskraft, die wir technischen Fortschritt nennen, zweitens, die Globalisierung, drittens, der Wertewandel, der mit der Individualisierung einhergeht, und viertens, der demographische Wandel.
Technischer Fortschritt, Globalisierung und Wertewandel haben schon die Väter der sozialdemokratischen Programmtradition beschäftigt, etwa in dem Bild von Basis und Überbau, von Technik und Gesellschaft, das Karl Marx in dem Vorwort zu seiner „Kritik der Politischen Ökonomie“ zeichnet. Er schreibt 1859: „In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt (…). Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um.“
Wie sich dieser gesellschaftliche Überbau im Zuge der Industrialisierung umwälzt, beschrieben Marx und Friedrich Engels schon 1848: „Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.“
Flexibilität und Sicherheit
Dies ist und bleibt der zentrale Widerspruch unseres Zeitalters: Die Ökonomie fordert mehr denn je Flexibilität, Kurzfristigkeit. Die Menschen aber brauchen Sicherheit, Langfristigkeit. Zwischen diesen beiden Polen, Flexibilität und Sicherheit, wird der Freiheitsdiskurs der Zukunft geführt. Dabei müssen wir uns politisch nicht für die eine oder für die andere Seite entscheiden, sondern eine vernünftige Balance finden, das rechte Maß, ein gut sozialdemokratisches „Ja-Aber“.
Neue Technik: Ja. Die treibende Kraft des technischen Fortschritts schafft uns neue Möglichkeiten, die Lebensbedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung umfassend zu befriedigen. Um die natürlichen Grundlagen für das Wachstum des Wohlstandes zu schonen und zu schützen, muss der Fortschritt eine neue Richtung haben: Wissenschaft und Technik müssen helfen, Energie effizienter einzusetzen und auf regenerative Quellen umzusteuern, Ressourcen sparsamer zu verbrauchen und Stoffkreisläufe aufzubauen, schließlich schädliche Abgase, Abwässer und Abfälle drastisch zu verringern. Neue Werkstoffe und Produktionsverfahren, Nano-, Bio- und Computertechnik können die Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung bilden. Zu dieser ökologischen Modernisierung, deren Rational nicht mehr „viel hilft viel“ heißt, sondern: „aus weniger mehr machen“, gibt es keine verantwortbare Alternative.
Aber: Wir müssen auch unsere soziale Umwelt schützen. Technischer Fortschritt ist kein Selbstzweck. Und die Freiheit des globalen Kapitalverkehrs ist kein Ersatz für die Freiheit jedes einzelnen Menschen, sein Leben selbst zu bestimmen. Seit der große Systemkonflikt, die atomare Konfrontation der Supermächte und Blöcke der Vergangenheit angehört, ist der Kapitalismus weltweit wie entfesselt. Seinem Streben nach einem Markt ohne Regeln, der beschleunigten Entkopplung von Realwirtschaft und spekulativen Gewinnchancen, der unkontrollierten Machtkonzentration bei globalen Wirtschaftsunternehmen, dem Ruf nach immer mehr Deregulierung und Entstaatlichung tritt bisher noch keine starke, ordnende Weltinnenpolitik entgegen. Noch drücken die Zumutungen ungleicher Konkurrenz auf Wohlstand, Arbeitsplätze und Sozialstaatlichkeit vieler Länder. Die Globalisierung menschenwürdig, das heißt, sozial gerecht und demokratisch zu gestalten, ist deshalb unsere Aufgabe in der deutschen Sozialdemokratie, in Europa und in der Weltgemeinschaft. Dazu gehört, gemeinsam die Freiheit zu hüten und den Frieden zu wahren, auch wo nicht-staatliche Gewalt die Menschen bedrängt, und vor schreiendem Unrecht, auch in entfernten Weltregionen, nicht die Augen zu verschließen. Die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen und des Weltmarktes ist heute keine Utopie mehr, sondern sie ist möglich geworden, wenn wir es wollen.
Gegenwärtig erleben wir einen Modernisierungsschub, der zu einem Teil ausgelöst ist durch neue Technik. Manche nennen das „digitalen Kapitalismus“. Doch die neue Technik rechtfertigt es nicht, die Menschen sozial zu entwurzeln. Zurzeit wird in der Globalisierungsdebatte ein Menschen- und Gesellschaftsbild propagiert, das geradezu gruselig ist. Der flexible Mensch, der zum flexiblen Kapitalismus passen soll, ist jung, gut ausgebildet, durchsetzungsstark, bereit, jederzeit umzuziehen, ohne ernsthafte Bindung außerhalb seines Berufs, allein interessiert an Karriere und Geldverdienen, heimatlos. Wo Grenzen aller Art und alte Sicherheiten verschwinden, in einer Welt, in der die – jedenfalls technische – Chance besteht, daß beinah jeder mit jedem in Kontakt tritt, und in der die Zahl der erreichbaren individuellen Lebensentwürfe größer ist als jemals zuvor, wird Identität zu einem kostbaren Gut. Die Erfahrung lehrt, daß unsere Identitätssuche, wenn zu viele Wurzeln in der Luft hängen, schändlich mißbraucht werden kann. Freiheit ist immer dann flüchtig, wenn sie keine Bindung an einen wertvollen Sinn, keine Beziehung zu anderen Menschen hat. Dabei sind Werte nicht beliebig. Wir folgen nicht dem kalten Ideal des monströsen Individuums, dessen Lebenszweck allein in der Mehrung seines eigenen Nutzens besteht. Wäre dies die Essenz menschlichen Zusammenlebens – unsere Gesellschaft wäre längst erfroren. Wir brauchen die Gemeinschaft in unseren Familien und Nachbarschaften, in der Gemeinde, im Verein und im Freundeskreis. Ohne die Sorge um und für andere können und wollen wir nicht leben. Wo die Freiheit, sich zu binden und zu engagieren, durch ökonomische und andere Zwänge bedroht wird, müssen wir eine Politik zum Schutz unserer sozialen Umwelt dagegensetzen. Das langsame, tatsächliche, tägliche Leben bleibt der Maßstab. Kein Jugendlicher wird schneller groß, wenn er im Internet mit größerer Rasanz von Seite zu Seite springen kann. Erziehung zu einem guten Leben braucht Anstrengung, Geduld und Liebe. Und nichts ist dabei wertvoller als das ruhige Vorbild der Erzieher.
Die Verlässlichkeit des sich nicht oder nur langsam Wandelnden schafft erst die Voraussetzung dafür, dass Menschen sich in neuen Verhältnissen behaupten, sie gestalten und weiterentwickeln können. Eine intakte soziale Umwelt ist so wichtig wie die Luft zum Atmen. Deshalb dürfen wir auch nicht der Zwangsvorstellung unterliegen, immer sofort alles ändern zu müssen, was sich – und sei es um des geringsten Vorteils willen – ändern lässt.
Die Familiengesellschaft als Maßstab
Eine überwältigende Mehrheit der jungen Menschen wünscht sich, auf Pläne für die Zukunft angesprochen, eine eigene Familie mit Kindern. „Aber so sehr wir die Bindungen heimlich wünschen“, schreibt die Berliner Journalistin Tissy Bruns, „so wenig vertragen sie sich mit den unendlichen Möglichkeiten der Selbstentfaltung, mit Tempo, Mobilität und Konkurrenz. Wer beides will, führt fast ein Doppelleben: Wie unglaublich fern und fremd ist die Berufswelt der Familienwelt.“ Da liegt eine wesentliche Aufgabe sozialdemokratischer Politik: Familie und Beruf müssen für Mütter und Väter zu gleichen Teilen und nach Wahl, so gut es geht, vereinbar werden – vereinbar durch gute Kindergärten mit langen Öffnungszeiten, kalkulierbare Schulzeiten, bessere Erziehungsurlaubsregelungen, flächendeckende Ganztagsschulangebote, bezahlbare Haushaltsdienstleistungen.
Wandeln muss sich insbesondere unser gesellschaftliches Wertesystem, das heute den unflexiblen, müden, sparsamen Eltern immer noch die Rolle der Dummen zuweist. Nicht die Single-Ästethik, sondern die Familiengesellschaft ist der Maßstab. Und die SPD wird zur familienfreundlichsten Partei Deutschlands.
Eine familienfreundliche Politik wäre auch gut, um der vierten großen Veränderungstendenz unserer Zeit, dem demographischen Wandel, zu begegnen. Die Dimension des Problems ist uns in Deutschland noch nicht wirklich klar. Es ist, wenn alles so weitergeht, die größte, einschneidenste Veränderung, vor der wir stehen.
Wenn dieses Land ein gewaltiges soziales Problem hat, dann dies, dass seine Bevölkerung dabei ist, sich selbst abzuschaffen. In Deutschland werden zwei Erwachsene seit längerem nur noch durch 1,3 Kinder ersetzt, und nichts spricht dafür, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern könnte. In den meisten anderen europäischen Ländern gibt es ähnliche Trends. Deutschland wird schrumpfen und vergreisen. Das Fatale an diesem Problem ist, dass es zwar völlig absehbar, aber in seinen Konsequenzen noch nicht aktuell ist. Noch schrumpft Deutschland nicht, wir haben 82,5 Millionen Einwohner und bleiben in dieser Größenordnung sogar noch eine Weile stabil; knapp die Hälfte der Bevölkerung ist erwerbstätig und erarbeitet den Wohlstand, von dem auch Kinder, Lehrlinge und Studenten, Arbeitslose, Kranke und Behinderte, Rentner, Pensionäre und Pflegebedürftige zehren.
Erst ab 2007 werden zunächst die Schülerzahlen stark zurückgehen. Bei den Studierenden wird der Einbruch 2008 erwartet. Ab 2020 steigt die Zahl der Rentner sprunghaft an, dann gehen die Kinder des Babybooms von Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in den Ruhestand. Das Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen, das heute 1:2,9 beträgt, entwickelt sich auf 1:1,4 im Jahr 2030. Sowohl die Rentner- als auch die Erwerbsgenerationen dieser so fern scheinenden Zukunft sind längst geboren. Nur Seuchen oder ein Krieg könnten die Proportionen noch wesentlich verändern. Heute schon läßt sich die Zahl der Neuruheständler im Jahr 2063 ziemlich exakt vorausberechnen. Die letzten von ihnen erblicken gerade jetzt das Licht der Welt. Wenn sich nichts dramatisch ändert, käme bereits im Jahr 2050 auf einen Erwerbstätigen ein Rentenempfänger.
Indem die Bevölkerungspyramide sich umkehrt, verliert der „Generationenvertrag“ für die soziale Sicherheit im Alter, bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit seine Grundlage. Das Sozialversicherungsprinzip mit Beiträgen auf den Faktor Arbeit kann nicht mehr funktionieren, wenn immer weniger Menschen arbeiten, aber immer mehr alt, krank und pflegebedürftig sind. Deshalb muß einerseits die Finanzierung auf eine breitere Grundlage, insbesondere aus Steuermitteln, gestellt und andererseits der Leistungsumfang überprüft werden. Jedem muß klar sein, daß bei steigender Lebenserwartung die Lebensarbeitszeit nicht immer kürzer werden kann, sondern im Gegenteil länger werden muß. Da Einwanderung unsere Probleme nicht lösen, sondern bestenfalls mildern wird, haben wir Antworten auf die historisch völlig neue Frage zu finden, wie Wohlstand und soziale Sicherheit in einer schrumpfenden Gesellschaft möglich sein können. Gleichzeitig aber müssen wir beginnen, den Trend der negativen Bevölkerungsentwicklung umzukehren durch ein gesellschaftliches Klima, in dem Kinder nicht als unmoderne Flexibilitätsbremse ihrer Eltern gelten.
Bei allen denkbaren Fortschritten durch Technik, Globalisierung und Wertewandel: Der einzige Weg, Vorsorge für die Zukunft zu treffen, sind und bleiben Kinder, die, wenn wir alt sind, erst erarbeiten, was dann verteilt werden kann. Sie wachsen in eine gerechte Gesellschaft hinein, wenn die sozialen Lasten für sie genauso erträglich sind wie für die Generation ihrer Eltern und wenn jeder, unabhängig von seiner Herkunft, die gleiche Chance erhält, seinen Platz durch Bildung und Leistung zu finden und sein Leben selbst zu bestimmen. Auf diesem Weg wollen wir niemanden überfordern und dürfen wir niemanden zurücklassen.
Ohne Programm geht es nicht
Wir erarbeiten also nach 140 Jahren ein neues, unser achtes Programm. Doch ist das überhaupt zeitgemäß, ein Parteiprogramm? Dazu schreibt der Politikwissenschaftler Franz Walter:
„Es ist wohl in der Tat so, dass die deutschen Parteien im 20. Jahrhundert vielfach zu programmlastig waren, dadurch oft starr, blockiert und dogmatisch wirkten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts aber droht die Gefahr von der anderen Seite: Die Parteien haben ihren programmatischen Ort verloren; den Mitgliedern fehlt der ideelle Treibstoff für ehrenamtliches Handeln. Der Abschied vom Programm hat die Parteien dabei nicht freier gemacht. Er hat ihnen die historische Sicherheit und Würde genommen, hat Loyalitäten reduziert, hat ihre Stabilität beeinträchtigt. Die programmlosen Parteien sind abhängiger geworden: von den Einflüsterungen und Kurzatmigkeiten der Demoskopen, von den Konjunkturen der politischen Leitartikel, von den Launen einer zappenden Telezuschauerschaft.“
Deshalb muß und will die SPD eine Programmpartei bleiben. Programmarbeit heißt, über den roten Faden, die klare Linie unserer Politik zu diskutieren. Wir dürfen diese Diskussion nicht durch reflexhafte Appelle zur Geschlossenheit unterdrücken. Immer brauchen wir ein vernünftiges sozialdemokratisches „Sowohl-als-auch“: sowohl Offenheit im Denken als auch Geschlossenheit im Handeln, sowohl alte Werte als auch neue Ideen.
„Die neue SPD. Menschen stärken – Wege öffnen“, herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung/Bonn, 2004.