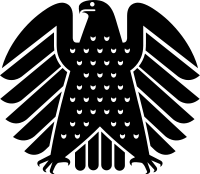Die allererste Entscheidung, die wir als frischgewählte rot-grüne Regierungskoalition 1998 noch vor der Parlamentskonstituierung zu treffen hatten, war eine sicherheitspolitische: Im Bonner Wasserwerk- Plenarsaal versammelten sich, weil der SPD-Fraktionssaal zu klein war, die 298 gewählten sozialdemokratischen Abgeordneten gemeinsam mit den ausscheidenden, aber noch amtierenden Kollegen – zusammen gut 400 alte und neue SPD-Mandatsträger –, um über die Aufrechterhaltung des Nato-Ultimatums gegen Rest-Jugoslawien zu befinden. Die Nato drohte mit militärischer Intervention, falls Milosevics Regierung nicht der UN-Resolution 1199 folgte und seine Truppen aus dem Kosovo zurückzöge. Würde nun Rot-Grün an der Bündnis-Linie der abgewählten Kohl-Regierung festhalten oder mit der gemeinsamen Nato-Politik brechen? Nach nicht allzu langer Diskussion bestätigten wir staatstragend die deutsche Position gegenüber dem Brandstifter auf dem Balkan – in der Erwartung, er werde schon einlenken, wenn nur der internationale politische Druck groß genug sei.
Aber was würden die Grünen tun? Als erste Regierungsmaßnahme in der Außenpolitik gleich Militär ins Spiel bringen? Joschka Fischer, der mit Kanzler Gerhard Schröder einig war, dass alles andere als Kontinuität im deutschen Handeln unabsehbare internationale Konsequenzen haben würde, stand vor einer ersten innerparteilichen Machtprobe als Außenminister.
Noch Wochen zuvor hatten grüne Bundestagsabgeordnete im Wahlkampf Demonstrationen und Kundgebungen gegen öffentliche Gelöbnisfeiern der Bundeswehr angeführt. Dank CDU-Verteidigungsminister Volker Rühe gab es in jener Zeit ausgesprochen viele solcher Termine – aus seiner Sicht ideologisches Spaltmaterial für die rot-grüne Konkurrenz. Bei dem entsprechenden Ereignis in meinem Wahlkreis Kiel ging ich zu beiden Events: Zur Gegenkundgebung des pazifistischen und antimilitaristischen Bündnisses (mit Angelika Beer als Hauptrednerin), um – demonstrativ – mit Gegendemonstranten ins Gespräch zu kommen; und zum Gelöbnisaufzug auf dem Rathausplatz – schließlich wollten wir Verantwortung für Deutschland übernehmen, auch für die Bundeswehr.
Vizekanzler Fischer hatte es erwartungsgemäß nicht leicht mit seiner hin und hergerissenen Partei, die Kontroverse wurde heftig und wie dort üblich auch immer gern sehr persönlich ausgetragen, bis hin zum Farbbeutelwurf auf das Trommelfell des Ministers. Am Ende entschied ein Sonderparteitag zugunsten der rot-grünen Regierungslinie. Auch die Grünen hatten jetzt erstmals A gesagt.
Kurz zuvor hatte die rot-grüne Regierung schon gemeinsam B sagen müssen. Milosevic war stur geblieben, der Nato- Luftkrieg gegen seine Streitkräfte begann am 24. März 1999. An den Luftschlägen beteiligten sich auch deutsche Jagdbomber. ECR-Tornados aus Lechfeld, für den Einsatz nach Piacenza in Italien verlegt, schossen 200 Raketen auf jugoslawische Flugabwehrstellungen.
Rot-grünes Regierungshandeln
Am Ende stehen heute: ein selbstständiges Kosovo, zu dessen auch interethnischer und interreligiöser Stabilität immer weniger internationale Militärpräsenz nötig ist (1999: 68.000 Nato-Soldaten, heute 6.000); eine demokratisch gewendete serbische Republik, die wie das Kosovo in die EU strebt; und Gerichtsverfahren gegen (den inzwischen verstorbenen) Milosevic und Radovan Karadzic vor dem Haager Tribunal. Damit müssen in der post-cold-war-Ära Diktatoren überall auf der Welt rechnen. Das internationale Recht entwickelt sich, und es bekommt Zähne.
Diese Maxime, Stärkung des Rechts gegenüber dem Recht des Stärkeren, verbindet die rote und die grüne Außen- und Sicherheitspolitik.
Das Bemerkenswerte an dem gemeinsamen rot-grünen Regierungshandeln auf diesem Gebiet (1998 – 2005) ist, dass alle wesentlichen Debatten nicht zwischen den beiden Parteien, sondern als inner-sozialdemokratische und inner-grüne Kontroversen ausgetragen wurden, manche sagen: zwischen Pazifisten und „Bellizisten“ in den beiden Parteien. Andere würden es so ausdrücken: zwischen den Gesinnungs- und den Verantwortungsethikern.
Dass es dabei auch zu Übersteigerungen kam – „Nie wieder Krieg!“ versus „Nie wieder Nazi-Barbarei!“ – gehört inzwischen zur Geschichte. Jedenfalls ist es ein Verdienst der Regierung Schröder/Fischer, dass sie keinen neuen deutschen Sonderweg erfunden, sondern dem souveränen Deutschland zu einem selbstbewussten Multilateralismus verholfen hat. Das ist nicht wenig.
Den Einsatz militärischer Gewalt zu außenpolitischen Zwecken sieht die deutsche Politik aus guten historischen Gründen nach wie vor skeptischer als viele andere Partner in Nato und EU. Aber es gibt kein prinzipielles Opt-out mehr wie noch zu den Zeiten von Helmut Kohl, der je zwei Wahlperioden in der alten und in der neuen Ära, vor und nach 1990, regierte. Deutschland geht nach den Weichenstellungen der rot-grünen Jahre, als sei dies ganz selbstverständlich, einen Weg der „europäischen Normalisierung“. Das ist inzwischen der neue außenpolitische Grundkonsens unserer Republik.
Schröders „Ja“ zur uneingeschränkten Solidarität mit den USA, als diese am 11. September 2001 angegriffen wurden, und sein „Nein“ zu den Vorbereitungen des Irak-Krieges 2002 markieren den erweiterten Handlungsspielraum der deutschen auswärtigen Politik. Beide Führungsentscheidungen wurden von SPD und Grünen anschließend jeweils mitgetragen – im Falle der Afghanistan-Intervention durchaus mit manchen Bauchschmerzen und Gewissensqualen, deshalb im Bundestag abgesichert durch die Verbindung der ersten Mandats-Abstimmung mit der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers. Und beide Entscheidungen waren zu ihrer Zeit in der Bevölkerung ausgesprochen populär, auch die Expedition an den Hindukusch, was heute gelegentlich verdrängt wird.
Dennoch, in Deutschland gibt es keinen Jingoismus, keinen emotionalen Hurra- Interventionismus, wie gelegentlich in den angelsächsischen Ländern, sondern ein relativ nüchternes Verhältnis zu Zwecken und Mitteln in der internationalen Politik. In Kontinuität zur Linie Willy Brandts und Helmut Schmidts, aber auch Helmut Kohls, setzte die Regierung Schröder/ Fischer auf eine Politik des Ausgleichs, der Mäßigung, der Konfliktprävention, des Handels und Wandels und der Diplomatie, eine Politik der guten Nachbarschaft mit beinah allen, die in der Weltgemeinschaft überhaupt dafür in Frage kommen. Freund- Feind-Denken und verbale Eskalation gelten als kontraproduktiv. Das mag ein Erbe der alten sozialdemokratischen Entspannungspolitik mit dem Osten sein. Deutschland hat nur gute Erfahrungen damit gemacht. Seit mehreren Jahren liegt die Bundesrepublik in einer weltweiten BBC-Erhebung zu der Frage, welchem Land man Einfluss auf die Weltpolitik gönne, auf Platz 1. Auswärtige Popularität ist gewiss nicht der einzige Maßstab für den Erfolg von Außenpolitik, aber doch ein Indiz dafür, dass offenbar vieles richtig gemacht wird. Die Fähigkeit, Exportmärkte für Güter und Dienstleistungen der deutschen Volkswirtschaft zu finden, wäre ein weiteres Indiz.
Zwischenfazit: In der Außen- und Sicherheitspolitik ist der Bestand an Gemeinsamkeiten, gemeinsamen Erfahrungen und gemeinsamen Zielen (Stichworte: Europa, Abrüstung, Entwicklung, Menschenrechte, Klima, Stärkung der UNO und internationaler Institutionen), zwischen SPD und Grünen außerordentlich groß. Und die gemeinsame Regierungspolitik wird, vielleicht mit Ausnahme des schwierig gewordenen Afghanistan-Engagements, als weit überwiegend erfolgreich bewertet.
Rot-Rot-Grün als Option?
Wenn es nun um mögliche Regierungsbündnisse mit der Linkspartei auf Bundesebene gehen sollte, ist zunächst festzustellen, dass es bisher natürlich keinerlei außen- und sicherheitspolitische Praxis dieser Partei im geeinten Deutschland gibt, nur Theorie, nur mehr oder weniger widersprüchliche Programmatik – wenn man einmal absieht von der Regierungspraxis der SED als DDR-Staatspartei. Wollte man aber nicht davon absehen, dann begegnen einem gelegentlich in öffentlichen Veranstaltungen Alt-Angehörige früherer Sicherheitsorgane, von Staatssicherheit und NVA, für die nach wie vor die Legitimationsfrage etwa beim Einsatz militärischer Gewalt lautet: zu „imperialistischen“ Zwecken oder zu „anti-imperialistischen“?
Im 24-seitigen „Entwurf für ein Programm der Partei Die Linke“ sind der Außen- und Sicherheitspolitik gerade einmal anderthalb Seiten gewidmet. Die selbstgestellte Frage „Wie schaffen wir Frieden?“ wird tendenziell pazifistisch und neutralistisch beantwortet. Hier haben sich anscheinend die Oppositions-Fundamentalisten durchgesetzt. Sie fordern die „Auflösung der Nato“ und „ein sofortiges Ende aller Kampfeinsätze der Bundeswehr. Dazu gehören auch deutsche Beteiligungen an UN-mandatierten Militäreinsätzen nach Kapitel VII der UN-Charta.“ Zwar bekennt sich der Programmentwurf zur „Stärkung der UNO“, aber an keiner Stelle wird erkennbar, unter welchen Umständen Die Linke bereit wäre, den Vereinten Nationen die Mittel zu geben, die nötig sind, um weltweit den Frieden zu wahren. Ob und wie sie zwischenstaatliche Gewalt, Bürgerkrieg, ethnische Säuberungen, Terror und Piraterie bekämpfen wollen oder ob sie wegschauen und es jeweils dabei belassen möchten, dass die aktiv und passiv Konfliktbeteiligten unter sich bleiben, das lässt das Programmpapier völlig offen. Dröhnende Bekenntnisse gibt es nur zu dem, was jeweils nicht in Frage kommt: dass „Krieg kein Mittel der Politik“ sei und dass man „eine Verknüpfung von zivilen und militärischen Maßnahmen „ ablehne.
Sollte es das Ziel sein, sich auf diesem Politikfeld scharf von SPD und Grünen abzugrenzen, so gelingt das mit solcher Art Auskunftsverweigerung mühelos. Die Überschriften in der Presse treffen schon zu: „Lafontaines Vermächtnis“ (Süddeutsche Zeitung, 23. März 2010) und „Programm gegen das Regieren“ (Tagesspiegel).
Im Deutschen Bundestag hat Die Linke wie ihre Vorgängerfraktion, die PDS, bisher noch jeden Auslandseinsatz deutscher Soldaten, sei es in Nato-, EU- oder UNO-geführten Missionen, abgelehnt. Damit mag die Partei sich bei einem Teil ihres Publikums als wahre und einzige konsequente Friedenskraft im Parlament profilieren – dem Weltfrieden und ihrer eigenen Politikfähigkeit hilft solcher Primitiv- Dogmatismus allerdings gar nichts.
Manchen der linken Bundestagsabgeordneten ist bei den Debatten und Abstimmungen zu UN-Einsätzen wie dem vor der Küste des Libanon (UNIFIL) durchaus anzumerken, wie unwohl sie sich bei ihrem stereotypen „Nein“ fühlen. Eine bemerkenswerte Lockerungsübung gab es immerhin schon einmal bei den Sudan-Mandaten, wo es um wenige deutsche UN-Militärbeobachter und technische Hilfe für die Friedensmission der Afrikanischen Union geht: Einige linke Abgeordnete enthielten sich der Stimme – und bekamen in ihrer Fraktion offenbar keine Klassenkeile.
So weit Die Linke sich im außen- und sicherheitspolitischen Feld bewegen müsste, um mit Rot-Grün koalitions- und regierungsfähig zu werden, so nah liegt diese Partei in einer anderen Frage zur Zeit bei CDU,CSU und FDP. Bei der Bundeswehrreform sind Milliarden-Sparversprechen, rabiate Umfangsreduzierungen, die Zerschlagung des Wehrpflicht-Prinzips, Standortschließungen und Verteidigungsminister Guttenbergs wohlfeile Schmähung der deutschen Rüstungsindustrie ganz nach dem Geschmack der Postkommunisten.
Auf einem Podium des Bundeswehrverbandes wurde dieser Tage ein Vertreter der Linken gefragt, wie klein denn seiner Meinung nach die (schon von 500.000 auf 250.000 Soldaten geschrumpfte) Bundeswehr noch werden solle, wie weit seine Partei denn, bitte, abrüsten wolle. Der Kollege zog sich elegant aus der Affäre: „Etwa so viel wie der Guttenberg“ war seine Ansage.